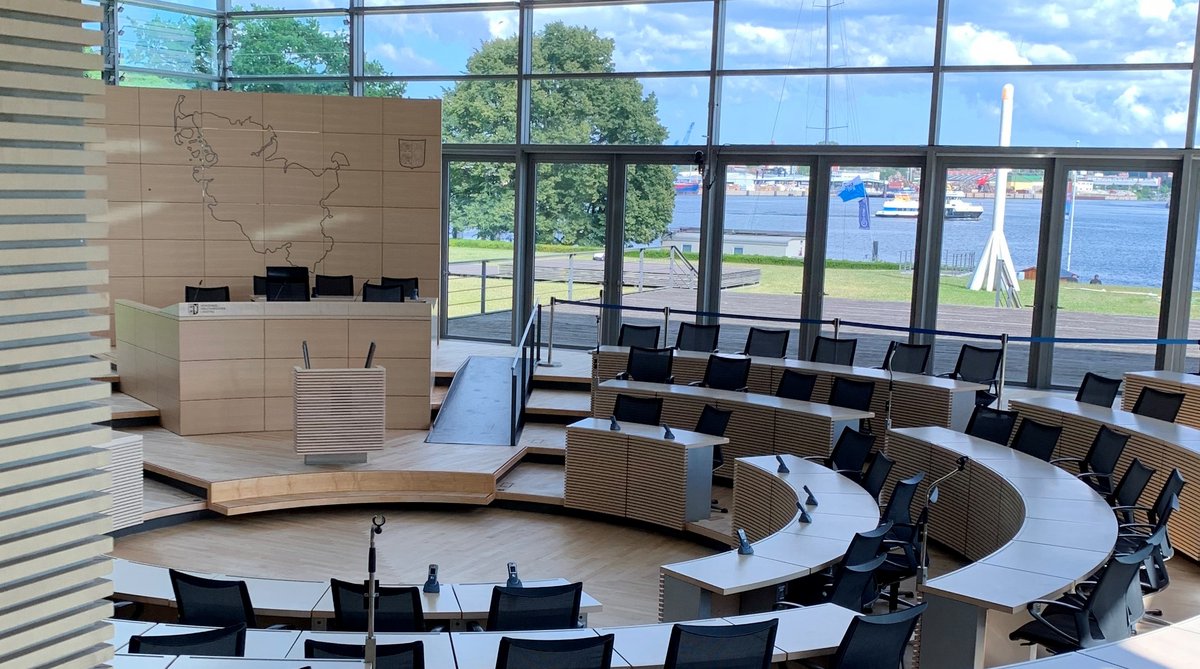

Rede vom 24. Januar 2024
Demokratie bedeutet anzuerkennen, dass es unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema gibt
Sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Abgeordnete,
das Thema Bürgerbegehren beschäftigt uns heute erneut, weil es der Volksinitiative gelungen ist, über 20.000 Unterschriften zu sammeln. Das ist eine sehr beeindruckende Zahl. Als ich bei der Übergabe der Unterschriften an den Landtag hier vor dem Haus dabei war, sprach mich ein Journalist an, ob ich bereit wäre, dazu etwas zu sagen. Ich sagte zu und er hielt mir sein Handy zur Aufzeichnung hin und seine erste Frage war: Haben die Grünen sich über den Tisch ziehen lassen? Diese Art der Betrachtung beschäftigt mich seitdem, denn ehrlich gesagt halte ich es für gesellschaftlich problematisch, einen Kompromiss als Niederlage für die eine und als Sieg für die andere Seite zu werten. Es mag der vermeintlich interessanteren Meldung geschuldet sein, aber für uns alle ist es doch unser Alltag, Kompromisse zu finden. Und das ist auch gut so, denn Demokratie bedeutet doch nicht, ich setze meine Meinung zu 100 Prozent durch und ansonsten habe ich verloren oder mich über den Tisch ziehen lassen. Und wenn wir hier auf Landesebene Kompromisse schlecht reden, wie soll das dann auf kommunaler Ebene funktionieren?
Denn bei Bürgerbegehren geht es darum, die eigene Meinung auf kommunaler Ebene durchzusetzen. Auch hier müssten sich eigentlich beide Seiten aufeinander zu bewegen. Manchmal klappt das nicht, und darum sind Bürgerbegehren an sich unverzichtbar. Aber sie sind weder das einzige Mittel zur Bürgerbeteiligung, noch das Beste. Bei einem Bürgerrat beispielsweise redet man miteinander, das ist ein konstruktiver Prozess. Bei Bürgerbegehren gibt es mehrere Arten, beispielsweise initiierende und kassatorische. Das initiierende Bürgerbegehren finde ich klasse, Menschen haben eine Idee, sammeln Unterschriften und bringen Ideen in ein kommunales Gremium ein. So weit so gut. Beim kassatorischen Begehren geht es darum, den Beschluss eines demokratisch legitimierten Gremiums zu kippen.
Das ist manchmal notwendig, wenn die Gemeinde- oder Stadtvertreter*innen nicht gesprächsbereit sind, was sie eigentlich sein sollten. Aber am Ende gibt es dabei immer Gewinner*innen und Verlierer*innen, und das kann besonders in kleinen Gemeinden ein Problem sein. Demokratie bedeutet für mich, anzuerkennen, dass es unterschiedliche Blickwinkel auch auf dieses Thema gibt: Die einen finden Bürgerbegehren schlecht, sie finden es völlig ausreichend, wenn nur die gewählten Vertreter*innen Entscheidungen treffen. Die anderen finden Bürgerbegehren geradezu ideal, um bei strittigen Fragen eine zügige Klärung herbeizuführen.
Wir Grüne sind für Bürgerbegehren, daher habe ich mich in den Verhandlungen mit unserem Koalitionspartner sehr dafür eingesetzt, dass wir eben keine Anhebung der Quoren auf 15 Prozent für Begehren und 30 Prozent für Entscheide bekommen und das auch noch landeseinheitlich, egal ob im Dorf oder in der Großstadt. Und wir haben in den Verhandlungen folgenden Kompromiss erzielt: Wir haben weiterhin eine Staffelung nach Ortsgröße, was entscheidend ist, um Bürgerbegehren und Bürgerentscheide überhaupt noch erfolgreich durchführen zu können. Und wir haben geringere Quoren geeint.
Ein Klimabegehren wie in Flensburg hätte mit Quoren von 15 und 30 Prozent keinen Erfolg mehr gehabt. Es gibt auch weiterhin für Initiativbürgerbegehren wie das Klimabegehren in Flensburg sechs Monate Zeit für die Sammlung von Unterschriften. Bei der Bauleitplanung sind die Fristen kürzer und wenn die Beschlüsse mit einer 2/3-Mehrheit gefasst werden, sind keine Bürgerbegehren dagegen mehr möglich. Dass wir da mitgegangen sind, hat auch damit zu tun, dass bei diesen Beschlüssen zur Bauleitplanung ohnehin Beteiligungsverfahren für Bürger*innen gesetzlich vorgesehen sind, ganz unabhängig von Bürgerbegehren.
Ja, wir Grüne hätten von uns aus gar nichts bei den Bürgerbegehren verändert und ja, die CDU hätte gern viel mehr verändert bei den Bürgerbegehren. Wir sind aufeinander zugegangen, haben hart in der Sache gerungen und einen Kompromiss erarbeitet und zu diesem Kompromiss stehen wir.
Vielen Dank!

Rede vom 12. Oktober 2023
Wir geben den Gemeinden mehr Flexibilität
Sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Abgeordnete,
in der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes hat die Jamaika-Koalition 2022 die Rahmenbedingungen festgelegt, wie sich Schleswig-Holstein bis 2035 entwickeln soll.
In diesem Landesentwicklungsplan wird Gemeinden auch vorgegeben, wie sehr sie in dieser Zeit wachsen dürfen. Dies wird ausgewiesen in Wohneinheiten.
Wenn wir mit unserem Antrag nun davon sprechen, kleine Wohnungen und gemilderten Geschosswohnungsbau zu privilegieren, bezieht sich das auf die Anrechnung dieser Wohneinheiten auf die Vorgabe.
Das lässt sich an einem Praxisbeispiel besser nachvollziehen: In unserem Dorf leben etwa 500 Menschen, zum Stichtag in 230 Wohneinheiten. Unser Dorf darf bis 2035 um 10 Prozent wachsen, also um 23 Wohneinheiten.
Nun macht es aber einen großen Unterschied, ob ich ein Einfamilienhaus gleich eine Wohneinheit habe oder in einem alten Bauernhaus viele Wohnungen ausbaue. Genau dies ist bei uns der Fall: Im alten Gasthof, der bisher durch die gewerbliche Nutzung nicht als Wohneinheit zählte, sollten auf einen Schlag 10 Wohnungen entstehen. Derzeit würden diese auf das Kontingent angerechnet mit 10 Wohneinheiten.
Im Sinne der Schaffung von mehr Wohnraum und der Innenverdichtung ist dieser Umbau natürlich zu begrüßen. Und dennoch hatte diese Ankündigung bei dem*der einen oder anderen Gemeindevertreter*in eine leichte Schnappatmung zur Folge. Denn viele Gemeinden möchten gerne mehr Einwohner*innen ansiedeln, sie erhoffen sich unter anderem mehr Mittel aus Umlagen und mehr Steuereinnahmen.
Und aus dieser Perspektive erscheint ein Einfamilienhaus, in das mehrere Personen einziehen, zielführender. Oft geht es auch darum, dass die nächste Generation möglichst nebenan ein Haus bauen möchte.
Kleine Wohnungen bis 50 qm sollen deswegen künftig nur noch als eine halbe Wohneinheit angerechnet werden. Denn so wird der Wohnungsausbau und somit die Innenverdichtung auch im ländlichen Raum attraktiver.
Und ja, wir brauchen dringend mehr Wohnraum, aber wir dürfen dabei unser Flächeneinsparziel nicht aus den Augen verlieren. Immer mehr Neubaugebiete, immer mehr Flächenfraß an den Dorfrändern, und das, während im Dorfkern die alten Gebäude verfallen. Das ist nicht die Lösung!
Wer hier bei uns über Land fährt, sieht sie häufig: Schöne alte Gebäude, die sehr oft viel zu groß sind für nur eine Familie. Allerdings könnte man in diesen großen Gebäuden gut mehrere Wohnungen schaffen.
Bei diesen kleinen Wohnungen denken wir auch an Wohnraum für Geflüchtete. Die Kommunen stehen derzeit vor großen Herausforderungen, die Menschen unterzubringen. Viele von ihnen müssen über Jahre in Flüchtlingsunterkünften leben und dies beeinträchtigt ihre Integrationschancen massiv.
Eine weitere Zielgruppe ist aber besonders relevant, wenn es um Flächenverbrauch und effiziente Ressourcennutzung geht: Und zwar ältere Menschen, die in ihrem Haus inzwischen ganz allein wohnen und denen es zu groß geworden ist. Ein Umzug scheitert aber häufig daran, dass die Menschen im Alter verständlicherweise nicht mehr so gern irgendwo ganz neu anfangen wollen.
Unsere Gemeindevertretung hat ein Projekt angeschoben, um älteren Bürger*innen eine Möglichkeit zu geben, in ihrem gewohnten sozialen Umfeld zu bleiben. Auf einem gemeindeeigenen Grundstück soll ein kleines Mehrfamilienhaus mit sechs bis sieben Wohnungen entstehen, vier davon barrierearm, für genau diese Zielgruppe.
Und das ist gemeint mit gemilderten Geschosswohnungsbau: Kleine Mehrfamilienhäuser, die sich beispielsweise mit 2,5 Etagen gut in das Dorfbild einfügen. Auch den gemilderten Geschosswohnungsbau wollen wir noch stärker als bisher privilegieren, um Gemeinden zu motivieren, diese Wohnform mehr zu unterstützen.
Insgesamt geben wir den Gemeinden hiermit mehr Flexibilität, um auf die aktuellen Herausforderungen reagieren zu können. Deshalb bitte ich um Zustimmung zu diesem Antrag.
Vielen Dank!

Rede vom 14. Juli 2023
GAK als tragende Säule vollständig erhalten - Auch in schwierigen Zeiten die Ländlichen Räume unterstützen!
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, Die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist in Deutschland im Grundgesetz verankert. Das ist großartig, denn sowohl das Leben in der Stadt als auch das Leben auf dem Land oder in den ländlichen Räumen hat Vor- aber manchmal auch Nachteile. Wir alle nutzen vielleicht in verschiedenen Lebenssituationen auch unterschiedliche Lebensräume und wollen dabei nicht abgeschnitten oder benachteiligt werden. Wir haben den Haushaltsentwurf des Bundes zur Kenntnis genommen, der bei den Mitteln für die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz deutliche Kürzungen ausweist. Die GAK Mittel sind – im Verbund mit EU-Mitteln - ein zentrales Finanzinstrument für den Erhalt lebenswerter ländlicher Räume. Aber auch bei der Unterstützung einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft, bei der Naturschutzförderung in der Agrarlandschaft und nicht zuletzt als wichtiges Instrument zur Finanzierung eines wirksamen Küsten- und Hochwasserschutzes. Als stark ländlich geprägtes Land zwischen den beiden Meeren ist die Kofinanzierung durch den Bund für uns in Schleswig-Holstein besonders wichtig. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden wir in Schleswig-Holstein von den Kürzungen unterm Strich zwar nicht so stark betroffen sein, wie zunächst befürchtet, weil die Mittel für den Küstenschutz und den vorsorgenden Hochwasserschutz angehoben wurden. Das ist wichtig! Und es ist mehr als erfreulich, aber dennoch birgt der gerade vorgelegte Bundeshaushalt einige Unsicherheiten – auch weil die Struktur der Gemeinschaftsaufgabe verändert werden soll. Deshalb wollen wir die Landesregierung mit unserem Antrag bitten, sich im Bund FÜR eine Verstetigung und somit gegen eine Kürzung der GAK-Bundesmittel einzusetzen! Welche Förderungen im Detail wo und wie verändert werden sollen, das können wir noch nicht genau absehen. Denn es gibt noch Unklarheit bezüglich der Verteilungsschlüssel bei einigen Maßnahmen. Und wir müssen auch zugeben, dass der Wunsch, weniger Mittel zweckgebunden zu vergeben, von den Bundesländern kam – ebenso wie die Forderung nach einer Modernisierung der GAK Mittel. Und es gehört zur Ehrlichkeit allerdings an dieser Stelle auch dazu, dass es Bundesförderungen gibt, die neu sind und zum Teil in die Themenfelder der GAK hineinreichen. Dazu gehört zum Beispiel die Förderung für Stallumbau, die Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement und das Programm natürlicher Klimaschutz. Damit lassen sich aber die Kürzungen bei den Kernaufgaben der GAK nicht rechtfertigen. Denn entscheidend ist, dass es unterm Strich weniger finanzielle Mittel geben wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Nach dem Entwurf des Bundeshaushalts zur GAK sollen vor allem auch Sonderrahmenpläne und zweckgebundene Mittel gestrichen werden. Solche Streichungen ohne einen alternativen finanziellen Ausgleich sind nicht zu verantworten. Mir als kommunalpolitischer Sprecherin unserer Fraktion ist es besonders wichtig, darauf hinzuweisen, wie außerordentlich wichtig GAK Mittel für große und kleine Projekte vor Ort wie z.B. bei der Ortskernentwicklung sind. Solche Projekte sind bedeutend für den Zusammenhalt auf dem Land! Wenn wir auch zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass wir in Schleswig-Holstein weniger von den Kürzungen betroffen sein werden, so gilt das für manche andere Bundesländer nicht – und dies betrifft auch gerade Regionen, wo sich viele Menschen ohnehin bereits abgehängt fühlen. Das darf nicht sein, denn das gefährdet unsere Demokratie. Der Bund darf sich aus seiner Verantwortung für gleichwertige Lebensverhältnisse nicht davonstehlen. Liebe Kolleg*innen, Ich hoffe, dass wir mit diesem Antrag ein klares Zeichen nach Berlin senden können. Es geht ja gerade um zusätzliche bzw. wachsende Herausforderungen durch den Klimawandel, durch die Klimakrise. Wir spüren und sehen es doch jeden Tag und mittlerweile überall! Der heißeste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnung, der Meeresspiegelanstieg – es geht doch gerade um diese Herausforderungen, denen wir uns in Schleswig-Holstein an den Küsten aber auch gerade im Bereich der Landwirtschaft und im ländlichen Raum stellen müssen! Wir brauchen vitale ländliche Räume, in Schleswig-Holstein, und auch überall sonst in Deutschland – Deshalb bitte ich an dieser Stelle um Unterstützung! Vielen Dank.

Rede vom 12. Juli 2023
Änderung der Landesbauordnung
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, wir wollen und wir müssen gemeinsam für die Zukunft bauen – und das ist gar nicht so einfach. Drastisch steigende Preise für Baumaterialien und Energie belasten das Baugewerbe – um fast 17 Prozent sind die Baupreise im vergangenen Jahr gestiegen. Das ist ein Anstieg, wie es ihn zuletzt vor mehr als fünfzig Jahren gegeben hat! Hinzu kommen steigende Zinsen und der erhebliche Fachkräftemangel, der sich durch nahezu sämtliche Gewerke zieht. Gleichzeitig wächst der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum überall in Schleswig-Holstein, unabhängig ob in der Stadt oder auf dem Land. Vielen Menschen fällt es zunehmend schwerer, eine bezahlbare Wohnung zu finden – nicht zuletzt sollen aber auch die dringend benötigten Fachkräfte in unserem Land angemessen leben können. Denn was nützen alle Bemühungen, Fachkräfte im Ausland anzuwerben, wenn sie hier schlichtweg keinen Wohnraum finden können. Bauen ist grundlegend, um das menschliche Bedürfnisse nach Unterkunft befriedigen zu können. Zudem ist die Bauwirtschaft eine der Schlüsselbranchen, wenn es um die Erreichung unserer Klimaziele geht. Wir stehen hier in Schleswig-Holstein, wie überall in Deutschland vor einer gewaltigen Herausforderung: Wir wollen und wir müssen CO2 einsparen. Das bedeutet eigentlich, wir müssten weniger bauen. Denn vom Material, über den Bau, die Nutzung, der Sanierung, bis hin zum Abriss – ist der CO2-Ausstoß im Gebäudebereich außerordentlich hoch. Gleichzeitig wollen und müssen wir mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Diesen Widerspruch aufzulösen, erfordert sehr viel Kompromissbereitschaft von allen Beteiligten. Ein Weg kann es sein, neue Experimentierräume zu schaffen. Und genau aus diesem Grund haben wir im vergangenen Plenum einen Antrag zur möglichen Einführung einer neuen Gebäudeklasse E eingebracht. Hiermit könnte man Raum schaffen für Vereinfachungen beim Bau und für die nachhaltige Verwendung von Baustoffen. Um für die Zukunft zu bauen, müssen wir bereit sein, auch ungewohnte Weg zu gehen. Wer früher davon gesprochen hat, Recyclingbeton für Gebäude einzusetzen, wurde belächelt. Heute wissen wir, wie kostbar Baustoffe sind und Wiederverwendung besser ist als Downcycling oder gar Entsorgung. Auch die Umnutzung von Bürogebäuden zu Wohnungen ist ein – vielleicht etwas ungewöhnlicher - Ansatz zur ressourcensparsamen Schaffung von Wohnraum. Wir müssen an vielen Punkten ansetzen und viele Details berücksichtigen: Die vorgeschlagene Gesetzesänderung ist genau eine solche Detailarbeit. Ein Beispiel aus dem Gesetzentwurf ist die Möglichkeit, nachträglich eine Wärmepumpe an Hauswänden anzubringen, auch wenn dadurch der Abstand zum Nachbargrundstück von 3m unterschritten wird. Ob Wärmepumpen, PV-Anlagen oder Windenergie – neue technologische Möglichkeiten der nachhaltigen Energieversorgung dürfen durch die Vorschriften der Landesbauordnung nicht behindert werden. Im Gegenteil: Um die Energiewende zu schaffen, müssen wir diese Möglichkeiten besonders begünstigen. Ein weiteres Beispiel für Detailarbeit: Um Baukosten zu senken und den Materialbedarf zu reduzieren, soll die lichte Höhe für Aufenthaltsräume um 10 cm gesenkt werden. Der Abweichungsparagraph §67 soll dahingehend geändert werden, dass aus einer Kann-Vorschrift wie bisher - eine Soll-Vorschrift wird. Das bedeutet, das bei Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften Genehmigungen zu erteilen sind, sofern Leben und Gesundheit nicht gefährdet werden und keine unzumutbaren Belastungen entstehen. Denn wir dürfen natürlich nicht den Zweck der Landesbauordnung vergessen. Diese dient im Wesentlichen der Gefahrenabwehr. Wir müssen mit der Landesbauordnung gewährleisten, dass dort, wo Menschen leben und wohnen, Gefahren für Leib und Leben, soweit es geht, gebannt werden. Genau das ist der Zweck dieses Gesetzes. Und das ist auch die Grenze, an der sich alle Änderungen ausrichten müssen. Zugleich ist es aber auch sinnvoll mit einheitlichen Vorschriften Verfahren, wo immer es möglich ist, zu vereinfachen. Aus diesem Grund begrüße ich grundsätzlich alle Änderungen mit dem Ziel, die Landesbauordnung der Musterbauordnung anzugleichen. Ich bin aber zurückhaltend, wenn es darum geht, hier von der Reduzierung von überflüssiger BÜRO-kratie zu sprechen. Jede Änderung der LBO muss – und das ist kompromisslos – die Sicherheit für Leib und Leben sowie die Förderung der klimaneutralen Bau-Wende zwingend berücksichtigen. Und das bedeutet manchmal aber eben auch dort Regulierung, wo es ohne vielleicht noch schneller oder günstiger – aber eben nicht besser - ginge. Vielen Dank.
Juni 2023
Zurück - mit neuer Kraft - im Landtag

April 2023
Leider hat dieses Jahr für mich nicht so gut angefangen, ich kämpfe seit einigen Monaten mit gesundheitlichen Problemen.
Daher ist meine politische Präsenz momentan nicht so, wie ich es mir wünsche.
Ich versuche trotzdem, so weit wie möglich Termine wahrzunehmen und Anfragen zu beantworten,
bitte aber um Verständnis, wenn das mal etwas länger dauern sollte.
Ich hoffe, bald wieder voll einsatzfähig zu sein und mich mit ganzer Kraft für meine Themen einsetzen zu können.
Ein großes Dankeschön an mein Team und meine Fraktion, die mich vertreten und unterstützen,
besonders an Jan Kürschner, MdL, der mir seine Stimme leiht und meine Reden im Plenum hält.
Rede vom 23. November 2022
Hundesteuer
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abgeordnete! Wenn man sich als neue Abgeordnete in der Datenbank des Landtags informiert, ob denn über das Thema Hundesteuer hier schon einmal beraten wurde, stellt man schnell fest, dass es offensichtlich ein Dauerbrenner ist. Faszinierend, besonders im Hinblick auf die Tatsache, dass es sich um eine kommunale Steuer handelt und die rechtliche Lage doch eindeutig ist. Dinge, die die Gemeinden vor Ort regeln können, sollen sie auch regeln. Grundsätzlich ist die Idee richtig, den Tierheimen zu helfen. Sie stehen derzeit vor besonderen Herausforderungen, weil sie viele Tiere aufnehmen müssen, die ihre früheren Besitzerinnen und Besitzer während der Coronapandemie angeschafft haben und nun doch nicht mehr haben wollen. Außerdem haben sie – wie wir alle – mit den stark gestiegenen Energiekosten zu kämpfen. Ob der Verzicht auf die Hundesteuer für den ersten Hund aus dem Tierheim da so viel weiterhilft, bezweifle ich allerdings. Denn was bedeutet das konkret? Bei uns in der Gemeinde sind das ganze 70 Euro. Wer sich wegen 70 Euro Einsparung im Jahr motiviert fühlt, einen Hund aus dem Tierheim aufzunehmen, der wird sich spätestens bei der ersten Tierarztrechnung überlegen, dass mit der Übernahme der Verantwortung für einen Hund noch ganz andere Beträge einhergehen, und dann den Hund womöglich wieder ins Tierheim zurückbringen. Damit ist wirklich niemandem geholfen. Das Thema Hundesteuer gehört in die Kommunen und nicht in den Landtag. Ich bin Gemeindevertreterin in einem Dorf mit etwa 500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Unsere Gemeindevertretung befasst sich regelmäßig mit dem Thema. Auch in unserer Gemeinde differenzieren wir inzwischen zwischen dem ersten Hund und weiteren Hunden. Wir besteuern ausgebildete Jagdhunde mit dem halbierten Steuersatz und Begleithunde beispielsweise gar nicht. Ich finde es richtig, dass die Kommunen selbst entscheiden, welche Hunde sie von der Hundesteuer ausnehmen wollen und wie sie die Hundesteuer im Rahmen einer entsprechenden Satzung ausgestalten. Im Oktober 2022 hat das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein berichtet, dass in Schleswig-Holstein die Kommunen jährliche Steuereinnahmen von fast 19 Millionen Euro durch die Hundesteuer haben. Wenn wir das gesetzlich einschränken wollten, müssten wir als Land auch für die Einnahmeausfälle der Kommunen aufkommen. In unserem Dorf ist die Größenordnung sehr viel überschaubarer, wir haben derzeit circa 3.800 Euro Einnahmen aus der Hundesteuer pro Jahr. Ich prüfe gerade, ob wir als Gemeinde einen guten Teil dieser Einnahmen aus der Hundesteuer dem Tierheim in der benachbarten Stadt spenden dürfen. Davon hat das Tierheim nämlich mehr. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
3 Minuten Beitrag vom 02. September 2022
Wahlrecht
Mein erster Beitrag im Plenum:
Ein sogenannter 3-Minuten Beitrag zum Thema Wahlrecht.
Im Landtag ist der Ablauf der Reden keineswegs willkürlich, sondern richtet sich nach Regeln,
die z.B. die Größe der Fraktion berücksichtigen.
Wenn man als Abgeordnete/r darüber hinaus noch etwas sagen möchte, kann man sich mit drei Fingern melden und
das Präsidium ruft einen dann auf für einen 3-Minuten-Beitrag.
Dabei ist es üblich, keine ausformulierte Rede vorzutragen, sondern maximal auf einen Zettel mit Notizen zu schauen.
Daher habe ich auch den Text meines Beitrages aus dem Protokoll des Landtages übernommen,
denn ich habe frei gesprochen, was für mich als neue Abgeordnete natürlich nochmal extra aufregend war:
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Wenn ich in diesen Tagen Gespräche mit Menschen führe, die ich überzeugen möchte, der nächsten Kommunalwahl doch bitte anzutreten und für ein Amt zu kandidieren, dann höre ich in diesen Gesprächen nicht nur die Frage: Wie viel Zeit wird mich dieses Ehrenamt kosten? Sondern auch: Welches Risiko gehe ich damit für mich und meine Familie ein? Hass und Hetze treffen schon lange nicht mehr nur prominente Politikerinnen und Politiker, denen man allerdings auch viel zu oft gesagt hat, es gehöre dazu. Ich möchte hier in aller Deutlichkeit sagen: Hass und Hetze gehören nicht zum Amt! Zunehmend trifft es aber auch Lokalpolitiker. Gestern stand in einem Zeitungsartikel, dass 46 Prozent der Lokalpolitikerinnen und -politiker schon Erfahrungen mit Anfeindungen gemacht haben. Ich kenne einen Fall aus Schleswig-Holstein, wo jemand aus der Lokalpolitik wegen einer Lappalie im Internet kritisiert wurde. Daraus wurde ein regelrechter Shitstorm, und es endete damit, dass er Morddrohungen an seine Privatadresse geschickt bekam. Das Auffällige daran war, dass diese Morddrohungen, wie man im Nachhinein festgestellt hat, gar nicht von Leuten aus seiner Stadt kamen oder aus Schleswig-Holstein, sondern aus ganz anderen Bundesländern. Angesichts dessen fragt man sich doch: Woher haben diese Leute die Privatanschrift? – Wir alle können uns denken, woher. Das geht nämlich durch das Internet, und dort werden irgendwelche Listen veröffentlicht. Wir sind in vielen Dingen, was den Datenschutz an- geht, unheimlich gut dabei – bei dem Schutz von Politikeradressen komischerweise nicht. Ich persönlich habe mich schon immer gefragt, welche Relevanz für die Wahlentscheidung es denn hat, zu wissen, wo genau jemand wohnt. Der Ort? – Ja. Lokale Themen zu kennen, ist wichtig. Man sollte also wissen, ob der Mensch aus dem Ort kommt, wo er kandidiert. Ich finde es sehr hilfreich, dass wir – so nehme ich es zumindest wahr – hoffentlich zukünftig die Wahl haben, ob wir unsere genaue Anschrift veröffentlichen oder ob wir Straße und Hausnummer weglassen. Ich stimme Ihnen zu, Herr Dr. Buchholz: Das kann natürlich nur ein Baustein sein – wir müssen noch sehr viel mehr tun –, aber es ist ein wichtiger Baustein. Daher bitte ich um Zustimmung zu diesem Antrag. – Vielen Dank.